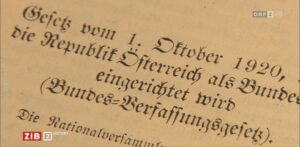Ich geb´s auf und melde mich hiermit offiziell aus dem Prognose-Business ab. Ich kann es offensichtlich nicht.
Dabei dachte ich, dass ich nach mehr als 30 Jahren journalistischer Erfahrung in der heimischen Politik die Rahmenbedingungen, Interessen und Akteur·innen halbwegs qualifiziert einschätzen kann. Deshalb hatte ich vor der Nationalratswahl hier im Blog ausführlich erklärt, warum der nächste Bundeskanzler mit größter Wahrscheinlichkeit wieder Karl Nehammer heißen wird. Und nach dem spektakulären U-Turn der ÖVP Anfang Jänner, dass es — immerhin: “Stand heute” — Herbert Kickl sein wird.
I rest my case.
Ganz offensichtlich habe ich die Rolle von Rationalität und Logik in der österreichischen Politik maßlos überschätzt und als Trost bleibt mir nur, dass es dem Professor — Peter Filzmaier nämlich, auf dessen Urteil ich sehr vertraue — sehr ähnlich geht.
Fakt ist: Nach jeder Logik hätten die “Dreiko”-Verhandlungen zu einer gemeinsamen Regierung führen müssen, weil jede der drei Parteien regieren wollte und jede durch das Scheitern ihre Position verschlechtert hat. Für SPÖ und Neos hieß es weiter Opposition, für die ÖVP Juniorpartner statt Kanzlerpartei. Und selbst diese Option blieb ihr nur, weil sie über Nacht ihr zentrales Wahlversprechen — keine Regierung mit Kickl — in die Luft gesprengt und ihren Parteichef geopfert hat. Ich hatte das nicht erwartet.
Aber woran ist nun Blau-Schwarz gescheitert?
Auch hier war die Ausgangslage klar: Für die FPÖ war es die erste Chance, einen Kanzler zu stellen, für die ÖVP die letzte Chance, in der Regierung zu bleiben. Die beiden Parteien haben schon mehrfach auf Bundesebene koaliert, sie stellen aktuell fünf gemeinsame Landesregierungen, vier unter ÖVP-Führung, eine mit einem FPÖ-Chef. Und niemand zweifelte daran, dass die ÖVP den Freiheitlichen inhaltlich weit näher steht als der SPÖ. Nachdem das “Nein zu Kickl” gefallen war, sollte das also relativ rasch gehen.
Die Fehlkalkulation
Doch offenbar gab es auf beiden Seiten eine zentrale Fehlkalkulation: Die ÖVP rechnete anscheinend damit, dass die Freiheitlichen so froh über ihre unverhoffte Regierungsoption wären — noch dazu als Kanzler-Partei —, dass sie in den Verhandlungen nicht allzu sperrig sein würden; ähnlich wie 2017 zwischen Kurz und Strache oder zuletzt bei den Landesregierungen in Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark.
Doch die FPÖ sah das ganz anders: Sie war der Wahlsieger und die ÖVP — die keinesfalls in Opposition will und auch keine Neuwahlen —hatte keine Alternativen mehr und würde ihr sehr weit entgegenkommen müssen. Und so legte Herbert Kickl Forderungen auf den Verhandlungstisch, als hätten die Freiheitlichen im September nicht 29 Prozent gewonnen, sondern 49.
Wobei schon rätselhaft ist, weshalb die FPÖ dabei auch Dinge verlangte, von denen sie wissen musste, dass sie für die ÖVP undenkbar sind, wie ein Ende der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern oder der steuerlichen Absetzbarkeit für Kirchenbeiträge. Mit rationaler Verhandlungstaktik ist das schwer zu erklären, das klingt einfach nach Provokation (wie schon Kickls Demütigungsrede vor Beginn der Gespräche). Trotzdem wäre es daran nicht gescheitert. Aber zwei zentrale Themen — die sich bei Koalitionsverhandlungen in Bundesländern nicht stellen — waren nicht überwindbar: Die EU-Politik und das Innenministerium.
Der Rollenwechsel
2017 hatte sich die FPÖ dem europapolitischen Kurs der ÖVP untergeordnet. Wahlsieger Sebastian Kurz nahm die EU-Agenden vom Außenministerium mit ins Kanzleramt und überließ der FPÖ großzügig das Außenamt (Karin Kneissl lebt heute als hauptberufliche Putin-Adorantin in Russland) und sogar das Innenministerium (für Herbert Kickl — bis zu seiner Entlassung). Aber den politischen Kurs der türkis-blauen Koalition bestimmte ganz eindeutig Kanzler Kurz. Heinz-Christian Strache war der Juniorpartner (“Minister für Sport und Freizeit”, spottete Kurz mal privat) — nicht nur formal, sondern vor allem politisch.
Diesmal sollte es andersrum sein. Herbert Kickl wollte das freiheitliche Europaprogramm (“EU-Wahnsinn stoppen”) in das Regierungsabkommen schreiben. Und auch sonst zeigt das geleakte Verhandlungsprotokoll zahllose FPÖ-Forderungen, die für die ÖVP schwierig bis inakzeptabel waren. Ausnehmend unfreundlich war auch Kickls erster Vorschlag zur Ressortverteilung: Er verlangte für die Freiheitlichen das Finanzministerium, das Innenministerium und im Kanzleramt weiterhin die Agenden für Medien, Kultur, Verfassung und EU.
Ab diesem Moment begannen die Verhandlungen zu kollabieren. Für die ÖVP war das Innenministerium von Beginn an unverhandelbar, dazu das Außenamt mit den EU-Agenden und auf das Finanzministerium hatte sie noch ernstlich gehofft. Am Ende scheiterte es am Innenministerium, auf dem beide Parteien ultimativ beharrten.
Und jetzt?
Letztlich haben sich beide verkalkuliert. Herbert Kickl ist mit der historischen Chance aufs Kanzleramt gescheitert und kann nun bestenfalls hoffen, bei der nächsten Wahl noch ein paar Prozent zu gewinnen, um mit noch höherer Parteienförderung weiterhin von der Oppositionsbank aus “das System” zu bekämpfen. Die ÖVP hat ihren Parteichef geopfert und dazu einen Gutteil ihrer Glaubwürdigkeit, aber sie kann zumindest damit rechnen, auch in der nächsten Regierung eine Rolle zu spielen.
Wie geht es nun weiter? Der Bundespräsident hat offenbar überlegt, ein Kabinett aus (Alt-)Politiker·innen und Expert·innen einzusetzen, das für die Sanierung des Budgets von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen im Parlament gestützt werden müsste. Vorher gibt es aber nochmal Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ, ob nicht doch noch eine Zweier- (oder Dreier-)Koalition möglich ist. Scheitert beides, gehen wir im Frühsommer wieder wählen.
Wer wird Österreich regieren?
Ich habe keine Ahnung.
Foto: Bundeskanzleramt Fotoservice / Andy Wenzel